– Es war mir ein Vergnügen
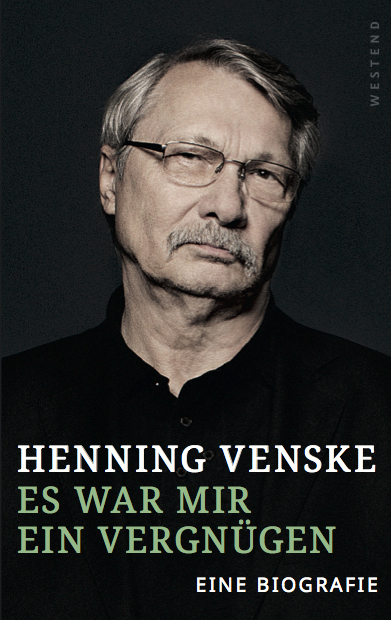
Henning Venske, Es war mir ein Vergnügen. Eine Biografie. Frankfurt am Main 2014.
448 Seiten. Hardcover mit Schutzumschlag. 22,99 Euro.
[Leseprobe, PDF] [Verlagsseite]
[E-Book, 9,99 Euro] [Amazon] [Bücher.de] [Thalia.de]
In einer Art Sittengemälde der Bundesrepublik erzählt Venske anhand seines Lebensweges die Geschichte dieses Landes, wie sie wahrscheinlich noch nie erzählt wurde.
Stets ist sein umfassendes künstlerisches Schaffen als Moderator, Schriftsteller, Schauspieler und Kabarettist eine Reflexion auf die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse: Willy Brandt, die Gründung der Grünen, die langen Kohl-Jahre, Schröder als Ministerpräsident und als Kanzler, die Jahre bei der „Lach und Schieß“, Mutlangen, die Schleyer-Entführung, die FDP. Vor allem aber besticht das Buch durch die zahlreichen persönlichen Erlebnisse Venskes, die die Ereignisse der letzten fünfzig Jahre immer wieder in ein anderes Licht stellen.
Rezensionen:
nachdenkseiten.de, Wolfgang Lieb:
Warum schreibt ein Satiriker und Kabarettist eine „Biographie“, sein Lebenswerk ist doch öffentlich? Das habe ich mich gefragt, als mir Henning Venskes über vierhundert Seiten starkes Buch mit dem Titel „Es war mir ein Vergnügen“ in die Hände kam. Ich hatte bestenfalls eine Sammlung von Texten aus früheren Veröffentlichungen oder Kabarettprogrammen erwartet, doch nach wenigen Seiten hat mich dieses Buch gefesselt. Was Hennig Venske bietet ist „Oral History“ im besten Sinne, nämlich erzählte deutsche Geschichte seit dem Ende der Nazizeit, der Flucht und der Not nach Kriegsende, des westdeutschen Kultur- und Theaterbetriebs der 60er und 70er Jahre bis hin zur zeitkritischen Satire und zum bissigen Kabarett heutiger Tage: Lebendige Erzählkunst eines Zeitzeugens nicht nur aus dem Blickwinkel des harten Überlebenskampfes eines Kulturschaffenden und Zeitkritikers, sondern von einem subversiven Idealisten, der mit Gelächter die Mächtigen zur Strecke bringen will.
Nicht viel jünger als Henning Venske habe ich mit seinen eindringlichen Erzählungen mein eigenes Erleben der gesellschaftlichen Veränderungen und der politischen Ereignisse Revue passieren lassen können. Aber ich habe das Buch auch meinen Kindern weiter empfohlen, weil sie darin konkreter als in jedem Geschichtsbuch und besser als ich mich erinnern könnte, die Nachkriegsgeschichte erzählt bekommen – politisch, wie auf den Feldern der Medien, des Theaters, der Satire und des Kabaretts.
Das Spannende ist, dass Henning Venske nicht nur seine früheren (Lebens-) Erfahrungen schildert, sondern dass er immer wieder aus der Erzählung aussteigt und (kursiv) Bezüge zur heutigen Zeit herstellt – sozusagen erfahrungsgespeiste Zeitkritik.
So etwa seine damalige Entrüstung über die Spiegel-Affäre 1962 und seine Enttäuschung darüber, wie das „Sturmgeschütz der Demokratie“ fünfzig Jahre später dasteht:
„2014 ist der Spiegel verkommen zu einem Vorderlader des Neoliberalismus, zu einer Bildzeitung für Leute, die sich genieren, in der Öffentlichkeit mit der Original-Bildzeitung gesehen zu werden. Und Spiegel-Online liest sich wie eine Boulevardzeitschrift für russenfeindliche Stimmungsmache, Kriegstreiberei und antisoziale Hetze. Kein Wunder, in der Chefredaktion sitzen mittlerweile die entsprechenden Fachkräfte aus dem Springer-Verlag….“
Und wenn Venske sein Erleben der „APO“ schildert, auf den Tod von Benno Ohnesorg und die Schüsse auf Rudi Dutschke und auf die „Enteignet Springer“-Kampagne zu sprechen kommt, prangert er sogleich den Zynismus des heutigen Chefredakteurs der Bildzeitung, Kai Diekmann, an, der nach der Bundestagswahl die Schlagzeile produzieren ließ: „Liebe Große Koalition, wird sind jetzt Eure APO!“
„Soviel blöde Geschichtsvergessenheit und widerliche Arroganz hat man selten: Ausgerechnet Springers Hetz- und Lügenblatt zum Sprachrohr einer neuen APO auszurufen, das ist wirklich dreist. Diese Anmaßung legt nahe, wie sinnvoll es wäre, die alte Forderung „Enteignet Springer“ wieder zum Leben zu erwecken.“
Venske war selbst kein 68er, er sieht aber die durch diese Bewegung angestoßenen positiven gesellschaftlichen Veränderungen genauso wie das, was nach dem „Marsch durch die Institutionen“ übrig geblieben ist:
„An dieser Stelle möchte ich ein bislang streng gehütetes Geheimnis verraten: Die sozialdemokratische „Reformpolitik“ (Gerhard Schröder & Co, Hartz IV und so weiter) ist nichts anderes als die Rache der 68er-Generation an der Arbeiterklasse. Denn: Die Arbeiterklasse hat sich 1968 geweigert, die Flugblätter zu verstehen, die Studenten an den Werkstoren verteilten…“
(Wobei Venske allerdings übersieht, dass Schröder nie ein richtiger 68er, sondern schon immer ein Opportunist war.)
Die „Biographie“, wie es auf dem Buchdeckel heißt, wird an zahlreichen Stellen brandaktuell und bitter:
„Offenbar glaubt Herr Gauck, dass hinter Militäreinsätzen Nächstenliebe und Wohltätigkeit stehen…Während der große Freiheitskämpfer Gauck beim Festakt am Tag der deutschen Einheit 2014 von der Freiheit schwadronierte und betonte „unser Land ist keine Insel“, sank – was für eine Koinzidenz – vor der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa ein Schiff mit über 350 Flüchtlingen, und den Strand füllten in Säcke gehüllte Leichen…“
Henning Venske zeichnet sich nicht als Held. Nein er beschreibt auch seine vielen Kompromisse, die er (vor allem beruflich) eingehen musste, um (ökonomisch) als freischaffender Künstler überleben zu können, aber seine eher anarchistische Empörung über die Verhältnisse hat ihn immer wieder zu neuen Herausforderungen getrieben. So hat er etwa1980 das Angebot abgelehnt für die Hamburger Grünen als Abgeordneter in den Bundestag zu rotieren, er wollte lieber kommentieren als verwalten. Und aus heutiger Sicht scheint es wie eine Bestätigung seiner damaligen Entscheidung:
„Die christliche Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt sagt in der ihr eigenen Naivität zu den Ursachen des Konflikts im Deutschlandfunk: „Jetzt geht es (in der Ukraine) um die Frage, ob man sich erpresserischer Hilfen aus Russland bedienen muss oder ob man sich konditionierter Hilfen aus der Europäischen Union bedienen kann.“ Russlands „erpresserische Hilfe“ ist für das betroffene Land gewiss kein Vergnügen. Aber was man von Brüssels „konditionierter Hilfe“ zu halten hat, sollte sich Frau Göring Eckardt bei Gelegenheit von den Arbeitslosen, Kranken, den Rentnern und den chancenlosen Jugendlichen in Griechenland, Spanien und Portugal erzählen lassen…
Sowohl im Osten wie im Westen werden die Völker mit der jeweiligen Regierungspropaganda zugeschissen.“
Bleibt – nach Charlie Hebdo – ganz aktuell noch zu klären. Was darf Satire?
„Kurt Tucholsky sagte: „Satire darf alles.“ Schade, dass wir darüber nicht mit ihm sprechen konnten: Mir war aber klar: Im „dürfen“ steckt eine Einschränkung, denn „dürfen“ und „alles“ schließen sich aus. „Dürfen“ bedeutet: Irgendwo ist eine Grenze. Satire „darf“ sich nicht „alles“ gestatten: Antisemitismus, Antikommunismus, Kinder-, Frauen-, Altenfeindlichkeit, Rassismus und Ausländerfeindlichkeit, Nationalismus, Volksverhetzung. Tucholsky sagte auch: „Der Satiriker ist ein gekränkter Idealist: Er will die Welt gut haben, sie ist schlecht. Und nun rennt er gegen das Schlechte an.“
Charles Chaplin ergänzte: „Ein echter Satiriker kann nur ein Mensch sein, der im Herzensgrund die Menschen liebt.“
So könnte kann man das Lebensmotto des Schauspielers, Regisseurs, Radioansagers, Musikmoderators, Satirikers und Kabarettisten und Autors zusammenfassen. Bei allen Höhen und Tiefen, die eine Nachkriegsbiographie notwendigerweise mit sich bringen musste, blieb Hennig Venske der Devise treu:
„Wir müssen verlangen, dass diejenigen, die die Macht ausüben, sich für alles, was sie tun, rechtfertigen müssen…Politisches Kabarett war immer subversiv…auf Pointenjagd, bei der die Mächtigen mit Gelächter zur Strecke gebracht werden…“
„Einen guten Lacher soll man nicht verachten!“ – das hätte auch als Titel dieses Buches gepasst.
„Es war mir ein Vergnügen“, Henning Venskes Biographie zu lesen.
jungle.world, Richard Gebhardt:
In seiner Autobiographie schildert der Kabarettist, Moderator und Schauspieler Henning Venske seine gebrochene Karriere in den Strukturen der linken Szene der Bundesrepublik.
Anfang der siebziger Jahre hatte der Künstler Henning Venske es nach entbehrungsreichen Jahren geschafft. Das 1939 in Stettin geborene Kriegskind musste auf der barfuß angetretenen Flucht gen Norden bitterste Not erleben. Später, als junger Mann, hatte Venske die westfälische Provinz hinter sich gelassen, um nach einem früh abgebrochenen Studium der Theaterwissenschaften in Köln schließlich an der Max-Reinhardt-Schule in Berlin eine Schauspielerausbildung zu absolvieren, die er aber aus ökonomischen Gründen beenden musste. Die Regieassistenz bei Theatergrößen wie Fritz Kortner und Samuel Beckett war ebenso aufregend wie brotlos. Doch in den Siebzigern wurde Venske zu einer Größe im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die Raten konnten endlich bezahlt, die Familie versorgt werden. Als Moderator der legendären Sendung »Musik aus Studio B« brachte er Schlager und Pop in die deutschen Wohnzimmer; in der »Sesamstraße« sahen ihn Millionen Kinder und Eltern. 1978 spielte er im »Tatort« einen Heidelberger Weinhändler, dem das Verlangen, auch mal abkassieren zu können, zum Verhängnis wird. Venske, damals ein saturierter Mann mit einem Häuschen in Ostfriesland, erinnert sich: »Einige der Handwerker, die am Umbau des Hauses in Wasserkoog beteiligt waren, sahen sich gemeinsam mit ihren Ehefrauen das Werk in der Kneipe Tetenbüllspieker an, und als ich am Ende erschossen in einer Heidelberger Gosse lag, soll die Gattin des Tischlers gesagt haben: Und wer bezahlt jetzt unsere Rechnung?«
Diese Anekdote, die amüsant illustriert, dass das sonntägliche Krimiritual in den Siebzigern eine nationale Institution war, ist eine von vielen aus Henning Venskes Biographie »Es war mir ein Vergnügen«. Der heute vor allem als Kabarettist bekannte Venske hat sich seinen Ruf als »Deutschlands meistgefeuerter Moderator« über Jahre hinweg redlich erworben. Sein neues Buch ist schon deshalb ein Lesevergnügen, weil er zahlreiche komische Geschichten aus seinen beruflichen Stationen gesammelt hat. Es gelingt ihm dabei, auch über persönliche Katastrophen ohne eine Spur von Larmoyanz zu berichten. Seine Erinnerung an Krieg und Flucht sind eindrucksvoll und stellenweise sogar berührend, seine Berichte aus der linken Szene der Republik ein Zeitdokument. Venske erzählt von einer progressiven politischen Kultur, die es derart nicht mehr gibt und deren widerständiges Potential er in seinen aktuellen Programmen stur verteidigt.
Venske, der 1980 von Konkret-Herausgeber Hermann L. Gremliza den Auftrag erhält, das auf esoterischen Pfaden umherirrende Satiremagazin Pardon als kritisches Organ wiederzubeleben, scheitert auch hier in Ehren. Indem er von Erfolg und Scheitern berichtet, legt er nicht nur seine Lebenserinnerungen vor, sondern auch eine Gegengeschichte der Bundesrepublik Deutschland. In kursiv gesetzten Ausführungen bricht Venske immer wieder mit dem Erzählstrang der Biographie, fügt persönliche Rück- und Ausblicke oder allgemeine Kommentare zum Weltgeschehen ein. Das sind die mitunter schwächeren Seiten, weil Venske hier in den anklagenden Tonfall eines Leitartiklers des Neuen Deutschland verfällt und dem Publikum plötzlich ein Flugblatt unter die Nase hält. Dabei ist Venske doch ein präziser Beobachter und begnadeter Erzähler. Köstlich sind Geschichten wie jene, die der einstmals passionierte Kiffer Venske über seinen Kollegen »Mr. Tagesschau« zu berichten weiß: »Man erzählte sich, dass Herr Köpcke das Toupet von Hans Albers auftrug, und ich glaubte das auch. Ich hatte Karl-Heinz Köpcke das erste Mal bewusst wahrgenommen, als ich meinen allerersten Joint rauchte, und ich hatte irrsinnig über ihn gelacht, wie der dasaß in all seiner hochamtlichen Wichtigkeit, als hätte er das gesamte Weltgeschehen persönlich veranlasst.«
Venske, der in den Siebzigern ein Sympathisant des in Norddeutschland einflussreichen »Kommunistischen Bundes« (KB) war, trat 1980 als Redner vor die Gründungsversammlung der Grünen, um vor der Falle der Parteibildung und der damit einhergehenden frühen Linksabgrenzung zu warnen. »Sägt euch doch nicht das linke Bein ab«, rief er den Delegierten zu, »ihr wisst doch noch nicht mal, wie die Krücken aussehen sollen, mit denen ihr uns davonhumpeln wollt.« Im tiefsten Herzen ist Venske kein Kommunist, sondern ein auch von Albert Camus inspirierter libertärer Linker, dessen Ideale einer herrschaftsfreien Gesellschaft unvermeidlich mit den Imperativen der Macht oder Parteiräson kollidieren.
Dass Venske nach einer versemmelten Abiturprüfung, einem früh beendeten Studium, diversen Rauswürfen und Wiedereinstellungen am Schiller- und Thalia-Theater auch als Moderator mehr als eine Auseinandersetzung übersteht, kennzeichnet seine Laufbahn. Die Bemerkung, »Musik aus Studio B« sei eine »Sendung für Blöde«, kostete ihn einen gutdotierten Job. Trocken beschreibt er, wie er von links oder sozialliberal gesinnten Redakteuren und Intendanten nach seinem jeweiligen Rausschmiss immer wieder ins System des öffentlich-rechtlichen Rundfunks eingeschleust wurde. Diese Anekdoten erinnern an Zeiten, in denen Künstler wie Venske zu den Reizfiguren der deutschen Konservativen auf den Intendanten- und Fernsehsesseln wurden und dennoch über eine eigene Hausmacht verfügten.
Die Kriegsnostalgie der Rechten war und ist Venske zuwider. »Im Alter von vier«, so erzählt er, »hatte Henning schon viel vom Krieg gelernt.« Etwa dass tote Menschen nicht aussehen wie schlafende. Und er sah, »dass auf der Straße neben einer sich krümmenden und stöhnenden Frau ein Baby lag, das den von Bomben erzeugten Luftdruck nicht überlebt hatte«. Es sind diese knappen Schilderungen, die in ihrer dichten Folge besonders eindrucksvoll sind. Familienangehörige, bei denen er mit seiner Mutter nach dem Krieg Zuflucht findet, werden liebevoll und zugleich bissig porträtiert. Die dominante Oma Ströhlein zum Beispiel »war groß und schlank, sie hielt auf Stil und Etikette, roch aber wie ein Depot von Mottenkugeln«. Bei ihrem Tod in den fünfziger Jahren konnte sich der Chronist noch von ihr verabschieden – »sie saß gut frisiert, gepflegt und in tadelloser Haltung in ihrem Bett und erteilte letzte Anweisungen«. Auch über die Drogensucht, den Entzug und schließlich viel zu frühen Tod seiner Zwillingskinder findet Venske wenige, anrührende Sätze.
Venske liefert ein beredtes Selbstzeugnis, vermeidet jedoch Pathos und längliche Meditationen über sein Innenleben. Wenn er über seine Depressionen berichtet, verliert er kein Wort zu viel. Lieber huldigt er seiner Liebe zu einem kühlen Pils und feiert die Nächte im legendären Hamburger Musikclub »Onkel Pö«. Die Westlinke, von der Venske anschaulich berichtet, war Mitte der Siebziger auf ihrem Höhepunkt. Die schillernden Allianzen jener Jahre sind heute unvorstellbar. Venske war damals ein Prominenter. Und dennoch gestaltete er für eine vom KB maßgeblich mitorganisierte alternative Kindertagesstätte Ende 1978 im überfüllten Hamburger Audimax die »Kinderhauskonzerte«. Venkse brachte mit seinen Genossen nicht nur Liedermacher wie Wolf Biermann, Franz-Josef Degenhardt und Konstantin Wecker auf eine gemeinsame Bühne. Auch Otto Waalkes spendete Geld, während Udo Lindenberg in der Band von Peter Herbolzheimer trommelte.
Venske erzählt seine Geschichte des roten Jahrzehnts. Für die St. Pauli Nachrichten las er auch einen »Porno-Report« ein. Die Texte stammten von Stefan Aust, Horst Tomayer und Henryk M. Broder, der, so Venske, »damals mit den Produkten des Springer-Verlages noch nicht mal seinen Fisch eingewickelt hätte«. Nur wer sich ändert, bleibt sich treu, werden die Zeitgenossen von damals bemerken. In jenen Jahren galt der furchtbar alberne Sankt-Pauli-Sexkitsch noch als progressiv und provozierte nicht nur die Restbataillone der fußlahm gewordenen »Aktion Saubere Leinwand«. »Stoppt Porno-Platte Venskes TV-Karriere?« fragte auch die sozialdemokratische Hamburger Morgenpost.
Seine TV-Karriere endete nicht, sondern nahm nach seinem Wechsel zum Kabarett Mitte der Achtziger eine entscheidende Wendung. In der Münchener Lach- und Schießgesellschaft wurde er zur festen Größe an der Seite von Dieter Hildebrandt. Venskes politisches Kabarett war und ist eine Kampfansage gegen rechts. Dem Kapitalismus wünscht er auch nach 1989 mit Ingrimm die Pest an den Hals. Die DDR, der er ansonsten nicht viel abzugewinnen mag, erscheint bei ihm dagegen als dritter Tarifpartner, der die schlimmsten Auswüchse der »freien Marktwirtschaft« gezähmt habe. Die westlichen »Slums am Rande des Wohlstands« aber seien »ein Gulag, bei dem das herrschende System auf den Stacheldraht locker verzichten kann«.
Die Banlieues des Westens als »Gulag«? Wo der Erzähler und Autobiograph einen süffisanten Stil pflegt, bleibt der Agitator Venkse bisweilen allzu plakativ. Und die ermüdende Tradition des linken Kabaretts als moralisierend-belehrende Besserungsanstalt hat auch Venske nicht immer überwunden. Seine Abneigung gegen eine Kritik des real existierenden Sozialismus ist aber Konsequenz einer Herangehensweise, die auch »Anti-US-Nummern« ablehnt. Es sei die Aufgabe des Kabaretts, vor der eigenen Haustüre zu kehren. Außerdem seien die USA die Schutzmacht Israels. »Und dafür bin ich wiederum dankbar«, schreibt Venkse. Er formuliert ehrliche Worte, deren Wahrheit sich heute nur wenige Linke eingestehen: »Es ist schon sehr schwierig, in dieser Weltpolitik einen Standpunkt zu beziehen und auch zu behaupten.«
Gerade die kursiv gesetzten Passagen seiner Biographie zeugen auch von diesen Schwierigkeiten. Doch kann nach der Lektüre dieser sehr persönlichen Kulturgeschichte der Bundesrepublik dem Ausspruch des Autors, »Es war mir ein Vergnügen«, nur beigepflichtet werden.